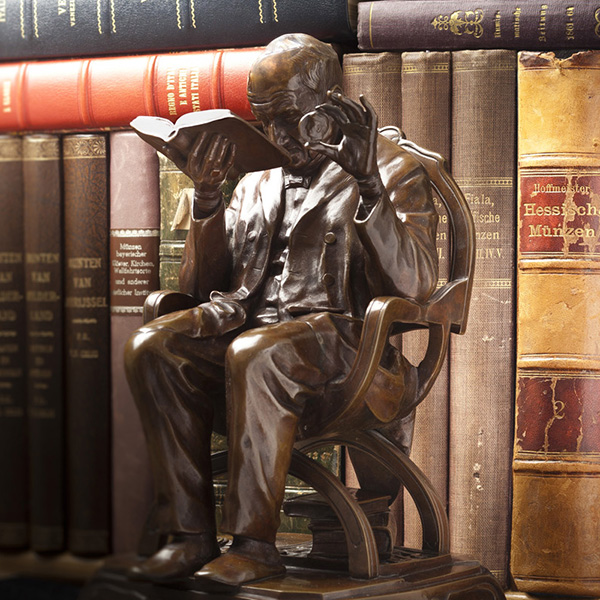Die Münzgalerie München stellt Ihnen hier einen Einstieg in die Wissenschaft der Numismatik und Beiträge zum Sammeln vor, die dem Wissenschaftler wie auch dem Liebhaber die nötigen Informationsmittel zur Verfügung stellen. Das „Münzlexikon“ vermittelt Grundkenntnisse zu Währungen, Münznamen und zur Geldgeschichte, die Kategorie „Das besondere Stück“ bietet Beispiele aus der Expertise unseres Hauses, die in zurückliegenden Ausgaben unseres „Intermünz-Kuriers“ erschienen sind. Die „Sammelgebiete“ stellen dem angehenden Sammler und dem „Schatzgräber zu Hause“ ausgewählte Handreichungen zur Verfügung, wie Münzen numismatisch und kommerziell einzuordnen sind.
Das hier vorgestellte Münzlexikon ist ein erprobtes Werk und versteht sich zugleich als ein „work in progress“. Es beruht auf dem Werk von Helmut Kahnt: Das große Münzlexikon von A bis Z (Gietl-Verlag, Regenstauf 2005), das wiederum eine veränderte Neuausgabe des „transpress Lexikon Numismatik“ von Heinz Fengler, Gerhard Gierow und Willy Unger (transpress VEB Verlag für Verkehrswesen, Berlin 3. Aufl. 1982) ist. Kahnt hatte die in seiner Vorlage gelieferten Literaturangaben gestrichen, eine Reihe von Artikeln hinzugefügt und diejenigen verändert, die allzu deutlich ein sozialistisches Geld- und Gesellschaftsverständnis zeigen.
Für die Internet-Ausgabe wurden die gescannten Artikel revidiert, offensichtliche Fehler stillschweigend korrigiert und die Voraussetzungen zur automatischen Verlinkung der Artikel miteinander hergestellt. Einige wenige Artikel, auf die Kahnt mehrfach verwiesen hatte, die jedoch die Aufnahme in seine Ausgabe nicht geschafft hatten, wurden aus dem „transpress Lexikon Numismatik“ nachgetragen, darunter „Marke“ und „Orden“. Kahnts Abbildungen wurden weitgehend übernommen, doch es ist geplant, die aus dem PDF ausgeschnittenen Bilder soweit möglich durch eigene, technisch bessere und scalierbare nach und nach zu ersetzen.
Die Münzgalerie ist offen für Veränderungen und Ergänzungen an diesem Lexikon und zu unseren Fachbeiträgen und würde sich über Anregungen seitens der Benutzer sehr freuen. Bitte scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen, wenn Sie Lust verspüren, an der Weiterentwicklung unseres numismatischen Angebots teilzunehmen.